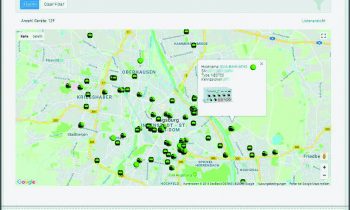Verkehrsinfrastrukturfinanzierung in Deutschland – Quo Vadis?
Jahrzehntelang wurde in Deutschland über eine zukunftsfähige Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur diskutiert – ohne echte Konsequenzen. Dieser Beitrag zeichnet zentrale Stationen nach und kritisiert das politische Zögern trotz klarer Empfehlungen hochrangiger Fachkommissionen. Von der Pällmann-Kommission 1999 bis zum gescheiterten Ausländer-Pkw-Maut-Desaster: Ein Überblick über verpasste Chancen der Nutzerfinanzierung.

Der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden hat im September 2024 eine verstärkte Diskussion über den Zustand der Brücken aus den 1960er- bis 1980er-Jahre ausgelöst (Bild: cdn.mdr.de)
In der dritten Aprilwoche dieses Jahres haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat ein rund 500 Milliarden Euro »schweres« kreditfinanziertes »Sondervermögen« für die Finanzierung der Infrastruktur verabschiedet; nachfolgend hat der Bundespräsident die dafür erforderliche Grundgesetzänderung »abgesegnet«. Ein beträchtlicher Teil der betreffenden Summe ist für die dringend notwendige Sanierung sowie den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur vorgesehen; deren Zustand gilt spätestens seit Anfang der 1990er-Jahre als zunehmend marode, sanierungs- und entwicklungsbedürftig. Im Bereich aller drei Verkehrsträger (Straße, Schiene, Binnenwasserwege) haben die Mängel ein Ausmaß angenommen, dass von einer zunehmenden »Instandhaltungskrise« gesprochen werden konnte/kann. Vor diesem Hintergrund sind seitdem zahlreiche politische Ansätze gemacht worden, dem angemessen Rechnung zu tragen; daraus wurden jedoch durchweg nicht die erforderlichen Konsequenzen gezogen. In der Folge werden maßgebliche Meilensteine diesbezüglich skizziert – mit Schwerpunkt Straßeninfrastruktur.
»Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung«
Im Herbst 1999 setzte der Bundesverkehrsminister eine fachlich und politisch hochrangig besetzte Kommission mit der betreffenden Bezeichnung ein. Die Kommission nahm ihre Arbeit am 14. Oktober 1999 auf. Vorsitzender war Wilhelm Pällmann, ein unter anderem langjähriger Vorstand der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Telekom. Expliziter Auftrag der Kommission war es, konkrete Empfehlungen für die künftige Finanzierung der Bundesverkehrswege zu geben, also der Bundesfernstraßen, der Bundesschienenwege und der Bundeswasserstraßen.
Der Schlussbericht der Kommission wurde am 9. 9. 2000 einstimmig verabschiedet. In der Liste der Hauptkomponenten des Lösungskonzeptes standen an erster Stelle:
• Schrittweise Umstellung von Haushaltsfinanzierung auf Nutzerfinanzierung
• Die Einführung von Benutzerentgelten muss ihren Niederschlag in Entlastungen bei den Verkehrssteuern finden
• Konsequente Anwendung des Nutzer-/Veranlasser-Prinzips
Der Verfasser dieses Beitrags war vom Vorsitzenden legitimiert, die Kommission in der Folge fachlich zu vertreten. Die Reaktionen auf zahlreiche Vorträge seinerseits zur Arbeit und zu den Empfehlungen der Kommission, vor allem im internationalen Raum, waren durchweg sehr positiv; in der Folge wurde Deutschland vielfach als exemplarischer Vorreiter in Bezug auf Straßenbenutzungsgebühren eingestuft. Unter anderem wurde der Verfasser in diesem Zusammenhang vom US-Kongress in das »Congestion Pricing«-/»Road-Pricing«-Komitee des Verkehrssektors (»Transportation Research Board«) der »Nationalen Akademien der Wissenschaften« der USA berufen.
In Deutschland wurden die Empfehlungen der Kommission nicht zuletzt auch von Verbänden und Interessenvertretungen aus dem Automobilsektor begrüßt. Mit »Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfrastruktur« wurde 2002 ein breit angelegtes Netzwerk von »Stakeholdern« etabliert, dessen Ziel es explizit in erster Linie war, die Umsetzung der Empfehlungen der Kommission zu unterstützen. Noch im Frühjahr 2004 hat ein hochrangiger Vertreter des Automobilclubs ADAC im Rahmen eines Parlamentarischen Abends zum Thema Verkehrsinfrastrukturfinanzierung in Berlin gefordert/formuliert: »Wir brauchen Pällmann 1:1«.
»Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft« und Einführung der Lkw-Maut
Die VIFG wurde 2003 als Eigentum des Bundes gegründet. Ihre Errichtung war politisch auf den Ergebnissen der Pällmann-Kommission zur zukünftigen Verkehrsinfrastrukturfinanzierung gegründet. Am 1. 1. 2005 begann die Erhebung einer entfernungs- und belastungsabhängigen Benutzungsgebühr der Bundesautobahnen durch schwere Lkw (»Lkw-Maut«); diese wurde seither schrittweise erweitert und differenziert. Vor dem Hintergrund der nachfolgend aber sehr zurückhaltenden Handhabung der betreffenden Materie wurde die VIFG jedoch im Jahr 2019 in die inzwischen gegründete »Autobahn GmbH« integriert.
»Managerkreis« der Friedrich-Ebert-Stiftung
Im Jahr 2009 veröffentlichte der »Managerkreis« der betreffenden SPD-nahen Stiftung eine Broschüre mit dem Titel »Verkehr finanziert Verkehr – 11 Thesen zur Nutzerfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur«. In diesem Zusammenhang daraus hervorzuheben sind insbesondere folgende Passagen:
• »These 6: ›Straße finanziert Straße‹ ist in vollem Umfang auf der Grundlage einer ›echten‹ Nutzerfinanzierung möglich und geboten; Nutzerfinanzierung bietet gerade bei der Straße wesentlich mehr Gestaltungsoptionen als Steuerfinanzierung.«
• »Fazit: Im Gegensatz zur traditionellen Haushaltsfinanzierung ist das Leitbild ›Verkehr finanziert Verkehr‹ in allen Sektoren tragfähig – vorausgesetzt, es wird den unterschiedlichen Rahmenbedingungen entsprechend ausgeformt. Es sollte in allen Sektoren des Verkehrs konsequent verfolgt werden. Eine weitere Verzögerung des Paradigmenwechsels oder gar ein Verzicht darauf sind weder politisch noch unternehmerisch verantwortbar.«
10 Jahre Regierungskommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung
Ebenfalls im Jahr 2009 erschien eine Veröffentlichung in Buchform unter dem betreffenden Titel mit der Ergänzung: »aktualisierter + erweiterter Appell zum Paradigmenwechsel«. Darin enthalten sind die Kurzfassung des Kommissionsberichts, ausgewählte aktuelle Fachbeiträge der Herausgeber sowie Positionspapiere/Beiträge aus Verbänden, Unternehmen und Wissenschaft. Die Präsentation erfolgte in den Räumen der Bundespressekonferenz in Berlin. Der Begriff Paradigmenwechsel bezieht sich dabei auf ein grundlegend anderes Verständnis gegenüber dem des Bundesverkehrsministers der »Ampelkommission« (Verwendung der Maut-Einnahmen für die Schiene). Die betreffenden Positionen stehen nicht zuletzt in vollem Einklang mit der zu jener Zeit bereits seit Langem geltenden EU-Verkehrspolitik.
EU-Verkehrspolitik
Die Meilensteine in diesem Zusammenhang sind insbesondere in den folgenden Dokumenten niedergelegt:
• Grünbuch »Faire und effiziente Preise im Verkehr«; 20. 12. 1995
• Weißbuch »Die Europäische Verkehrspolitik bis 2010«; 12. 9. 2001
• Weißbuch »Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem«; 28. 3. 2011
Im Weißbuch von 2011 heißt es unter anderem: »Bei Pkw werden Straßenbenutzungsgebühren immer mehr als Alternative zur Generierung von Erträgen und zur Beeinflussung des Verkehrs- und Reiseverhaltens angesehen … Langfristig ist das Ziel, Nutzerentgelte für alle Fahrzeuge und das gesamte Netz zu erheben, um mindestens die Kosten der Instandhaltung der Infrastruktur, der Staus, der Luftverschmutzung und der Lärmbelastung anzulasten«.
Im Jahr 2006 hatte die EU-Kommission im Rahmen ihres Programms »Implementing Pricing Reforms in Transport« (Einführung von Reformen der Bepreisung im Verkehrssektor »IMPRINT«) eine »Expert Group on Interurban Roads« eingesetzt. Im Mittelpunkt der Arbeit der Expertengruppe, an der auch mehrere deutsche Fachleute beteiligt waren (einschließlich des Verfassers dieses Beitrags), standen die Straßenbenutzungsgebühren.
Mit Datum vom 8. 7. 2008 hatte die Kommission zudem das sogenannte »Greening Transport Package« verabschiedet. Die offizielle Presseerklärung dazu beginnt mit der Formulierung: »Die Europäische Kommission hat heute ein Paket von Initiativen zur Ökologisierung des Verkehrs auf den Weg gebracht, mit dem der Verkehrssektor in Richtung Nachhaltigkeit gelenkt werden soll«. Darin sind unter anderem verankert:
• Umstellung von Steuerfinanzierung auf Nutzerfinanzierung
• Gültigkeit für alle Straßentypen
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des Deutschen Bundestages
Am 13. 4. 2011 führte der Ausschuss eine öffentliche Anhörung zum Thema »Verkehrsinfrastruktur« durch. Dabei zitierte der Verfasser dieses Beitrags aus einem seinerzeit aktuellen hochqualifizierten Gutachten für den US-amerikanischen Kongress: »Direkte Gebühren in Form entfernungsabhängiger Benutzungsgebühren … sind die langfristig wirkungsvollste und nachhaltigste Option … die Finanzierung des Systems zur Verfügung zu stellen … Entscheidend ist, dass entfernungsabhängige Benutzungsgebühren die einzige aller Optionen ist, durch die neben der Erzielung von Einnahmen der Umfang zusätzlicher Kapazitäten dadurch vermindert werden kann, dass die verfügbaren Kapazitäten effizienter und nachhaltiger genutzt werden können «.
Kommission »Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung«
In Umsetzung eines Beschlusses der Verkehrsministerkonferenz der deutschen Bundesländer wurde am 1. 12. 2011 eine Bund-Länder-Kommission mit der betreffenden Bezeichnung eingesetzt. Vorsitzender war der ehemalige Verkehrsminister von Sachsen-Anhalt, Karl-Heinz Daehre. Im Rahmen der Arbeit der Kommission wurde der Verfasser dieses Beitrags in seiner Funktion als wissenschaftlicher Berater des Gremiums unter anderem damit beauftragt, ein »Szenario für eine schrittweise Einführung von entfernungs-/belastungsabhängigen Straßenbenutzungsgebühren für alle Kraftfahrzeuge auf allen Straßen« zu erarbeiten. Das Ergebnis wurde persönlich mit dem Generaldirektor Verkehr bei der EU in Brüssel abgestimmt; es stand nach dessen Überzeugung in vollem Einklang mit der diesbezüglichen EU-Politik. Das Konzept wurde jedoch nicht direkt in den Abschlussbericht der Kommission (Dezember 2012) aufgenommen; im Anhang wird lediglich dessen Existenz vermerkt und auf die Möglichkeit seiner Einsicht im Gebäude des Bundesrates hingewiesen.
In dem »Instrumentenkasten« des Berichts sind aber explizit als Optionen genannt:
• Ausweitung Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen
• Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Straßen
• Infrastrukturabgabe aller übrigen Kraftfahrzeuge
• City-Maut
Das »Ausländer-Pkw-Maut-Desaster«
Anfang Juni 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg das vom Bundesverkehrsministerium letztendlich verfolgte Konzept einer »Ausländer-Pkw-Maut« für nicht EU-konform erklärt und deren Einführung untersagt. Entscheidend dafür war die Einordnung der Konstruktion als diskriminierend für EU-Bürger außerhalb der Bundesrepublik. Zunächst war ein (EU-konformes) allgemeines Pkw-Maut-Konzept geplant gewesen; das war dann aber verworfen worden.
Der oberste Gerichtshof hat sich mit seiner Entscheidung auch gegen die Auffassung der EU-Kommission positioniert, die nach einigen Änderungen des betreffenden Konstruktes – einschließlich seiner Umbenennung von »Ausländer-Maut« in »Infrastrukturabgabe« und »Pkw-Maut« – signalisiert hatte, dass sie keine grundlegenden Einwände mehr habe. Daraufhin hatte der amtierende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer umfangreiche vorbereitende Maßnahmen für eine Einführung der Gebührenerhebung im Jahr 2020 veranlasst – einschließlich der Beauftragung der Betreiber-Unternehmen. Das hatte dann letztendlich nicht unbeträchtliche finanzielle Belastungen des Bundes für Schadensersatzzahlungen zur Folge.
Bemerkenswert war immerhin das nach dem betreffenden EuGH-Urteil viel zitierte Motto: »Die Maut ist tot, es lebe die Maut«. Von nicht wenigen Stakeholdern war in diesem Zusammenhang gefordert bzw. empfohlen worden, das Ereignis zum Anlass zu nehmen, nunmehr schnellstmöglich den tatsächlichen systematischen und umfassenden Einstieg in eine EU-konforme, effiziente und faire Finanzierung der Straßeninfrastruktur zu betreiben.
Kommission »Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung«
Die Kommission wurde am 11. 4. 2013 von der Verkehrsministerkommission der Länder (VMK) eingesetzt; Vorsitzender war der ehemalige Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig. Die Vorlage der Ergebnisse/der Beschlussempfehlungen zu einer »Sonder-VMK« erfolgte bereits am 2. 10. 2013. Darin werden unter anderem ausdrücklich auch die Optionen einer deutlich erweiterten Nutzerfinanzierung im Straßensektor angesprochen – von einer Ausweitung der Lkw-Maut (hinsichtlich der Gewichte und der Geltung) bis zur »Neuschaffung von Gebühren/Abgaben für Pkw«.
Expertenkommission »Stärkung von Investitionen in Deutschland«
Die Kommission unter dem Vorsitz des DIW-Präsidenten Marcel Fratzscher wurde im August 2014 vom Bundeswirtschaftsminister eingesetzt. Die Übergabe ihres Berichts erfolgte am 21. 4. 2015. Zum Thema Bundesfernstraßen heißt es darin:
• Schaffung einer öffentlichen »Verkehrsinfrastrukturgesellschaft für Bundesfernstraßen«
• Finanzierung überwiegend oder ausschließlich aus Nutzerentgelten – ohne Mehrbelastungen der Pkw-Nutzer
Reform des Gesetzes zur Erhebung der Lkw-Maut auf Bundesfernstraßen
Mitte 2023 hat das Bundeskabinett der betreffenden Reform zugestimmt. In diesem Zusammenhang gelangte auch die Pkw-Maut wieder in die öffentliche Diskussion – bemerkenswerterweise sowohl seitens der »Wirtschaftsweisen« als auch des Umweltbundesamtes. Die Diskussion angestoßen hatten die Wirtschaftsweisen in ihrem Frühjahrsgutachten. Dort heißt es, dass die teils marode Verkehrsinfrastruktur modernisiert und ausgebaut werden müsse, mit Blick auf Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. »Dafür sind höhere Infrastrukturausgaben erforderlich, für die eine stärkere Nutzerfinanzierung, beispielsweise eine fahrleistungsabhängige Pkw-Maut, herangezogen werden sollte«. Das Bundesverkehrsministerium erteilte dem umgehend eine Absage. Man habe die Überlegung zur Kenntnis genommen, werde sie aber nicht verfolgen. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium, Daniela Kluckert, nannte die Idee sogar »absoluten Irrsinn«.
Schlussfolgerungen
Vor dem oben skizzierten Hintergrund kann das bereits seit Jahrzehnten praktizierte politische Handeln in dem betreffenden Zusammenhang kaum anders eingeordnet werden als »Systemversagen« und Paradebeispiel für die viel zitierte politische Positionierung »Fachwissen stört nur«. Falls nicht doch noch eine Kehrtwende erfolgt, sollte die Verwendung der für die Verkehrsinfrastruktur in dem verabschiedeten Sondervermögen vorgesehenen Mittel jedenfalls wenigstens mit einer nicht unmaßgeblichen Umsetzung der oben skizzierten – und mit der EU-Verkehrspolitik kompatiblen – Empfehlungen hochrangiger deutscher Fachkommissionen/Fachleute kombiniert werden. Das würde eine effizientere, sparsamere und systemgerechtere Verwendung der eingesetzten finanziellen Ressourcen zur Folge haben.
Autor:
Dr.-Ing. Andreas Kossak
22453 Hamburg